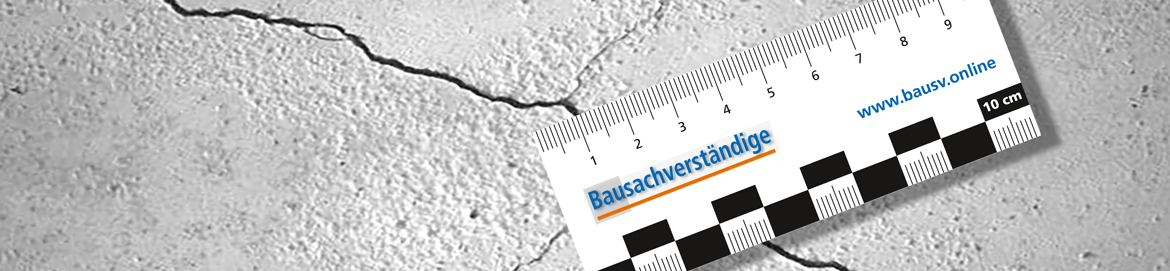Dipl.-Ing. Heike Böhmer, Geschäftsführende Direktorin des IFB: Bei den aktuellen Diskussionen um das Planen und Bauen liegt der Fokus regelmäßig auf dem Widerspruch zwischen den Notwendigkeiten und den Möglichkeiten, also zwischen (möglicherweise zu) hohen Anforderungen und dem technisch, personell bzw. finanziell Machbaren.
Es stellt sich die Frage, ob dieser Widerspruch auch direkte Auswirkungen auf die Planungs- und Bauqualität hat, denn wir stellen durchaus Veränderungen bei unseren jährlichen Schadenanalysen fest. Dazu zählen die kontinuierlich steigenden Schadenkosten und auch fast schon klassische Schäden, wie zum Beispiel Feuchteschäden, die möglicherweise eine Folge von zu hohen Anforderungen sind.
Prof. Dietmar Walberg: Leitthema bei dieser Fragestellung ist – mit Blick auf den juristischen Hintergrund – die Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Im eigentlichen Wortsinn ist damit gemeint: Was kann die Baubranche leisten, was versteht sie und was kann sie umsetzen? Und aus meiner Sicht sind wir von dem, was wir glauben zu können und von dem, was wir tatsächlich leisten können, noch sehr weit entfernt. Hier spiegelt sich nach meiner Wahrnehmung die gleiche Konfliktlage wider, die wir gerade in der Gesellschaft haben: Entwicklungen, die vielleicht theoretisch sinnvoll und machbar sind, aber in der Umsetzung (auf der Baustelle) noch keine wirkliche Rolle spielen.
Ein Widerspruch zwischen Erkenntnis und Fähigkeiten. Wir sind mit unseren Theorien und dem, was wir voraussetzen, weit vorgeprescht, haben aber die, die es in der baupraktischen Realität umsetzen müssen, nicht mitgenommen. Diese Spannungslage ist die Basis von Mängeln und Schäden, wie wir sie in der Praxis sehen, mit zunehmend hohen Kostenfolgen. Dabei stellen wir fest, dass alles, was wir heute erstellen, immer weniger Toleranz zulässt. Frühere Konstruktionen waren robuster und haben auch den ein oder anderen Fehler verziehen, das ist heute nicht mehr so.
Mein Leitgedanke als Einstieg also: Wir überfordern die Baupraxis, und wir überfordern auch die Materialien.
Böhmer: Mit dem juristischen Blick sind die Zusammenhänge um die Anforderungen, um die allgemein anerkannten Regeln der Technik noch einmal anders zu bewerten?
RA Michael Halstenberg: Kritisch zu bewerten ist zuallererst, dass schätzungsweise 90% der am Bau Beteiligten nicht mehr in der Lage sind, die ganz konkrete Funktion von technischen Regelwerken, das heißt, wie sie wirken, wann sie gelten und welche Bedeutung sie haben, richtig darzustellen. Das heißt, ein ganz großer Teil der am Bau Beteiligten versteht das System nicht mehr, weiß aber, dass er am Ende für das Arbeitsergebnis haftet.
Darüber hinaus haben wir folgendes Problem: Wir haben einerseits formale Regelwerke, die eigentlich nur Hilfsmittel sind, und wir haben andererseits den Anspruch, dass etwas funktionieren soll. Zwei Welten, die fehlerhaft miteinander verbunden werden: Menschen entscheiden sich heute im Zweifel gegen das Funktionieren und für das formale Erfüllen von Regelwerken. Juristisch nachweisen lässt sich leider einfacher, ob etwas formal richtig oder formal fehlerhaft ausgeführt wird; berücksichtigt wird dabei aber selten, dass Regelwerke oft nicht aufeinander abgestimmt sind, sich zum Teil widersprechen und immer neue Anforderungen hinzugefügt werden.
Am Ende führt dieses »blinde Anwenden und Erfüllen nicht abgestimmter, immer neuer Regeln« nur noch mit Glück dazu, dass ein Bauwerk auch in allen Punkten funktioniert. Aber eigentlich ist das System mittlerweile so konstruiert, dass Mängel und Schäden am Ende unvermeidbar sind.
Die Frage nach dem »Was können wir tun?« wird oft mit Vorschlägen zu Verfahrenserleichterungen oder mit dem Ruf nach Digitalisierung beantwortet, sie lösen das Kernproblem aber nicht. Ich führe das darauf zurück, dass auch die Regelsetzer und die Politik das System der technischen Regelwerke und deren juristischer Einordnung vielfach nicht mehr im Detail verstehen. Das Verschieben von Zuständigkeiten oder das Ändern von kleinen Details helfen nicht, das Grundproblem der großen Komplexität zu lösen, weil es am Bauwerk und dessen Qualität nichts ändert.
Denken wir zum Beispiel an die neuen Anforderungen des Green Deal, etwa die Recyclingfähigkeit von Materialien und Bauwerken, dann kommt wieder viel Neues hinzu. Da kann man verstehen, dass die Bauschaffenden am Ende nur noch eine lange Liste formaler Anforderungen abarbeiten, die sinnhafte Gesamtschau auf das Bauwerk aber aus dem Blick gerät.
Böhmer: Welche kluge Strategie, welches neue Denken kann denn dieses Problem lösen? Das Ziel, wieder mehr robuste, funktionale, gut nutzbare, bezahlbare und werthaltige Qualität zu bauen, die nachhaltig im eigentlichen Sinne ist, verfolgen wir doch eigentlich alle?
Walberg: Grundsätzlich ist es wichtig, sich gemeinsam darauf zu verständigen, was wir von einem Gebäude erwarten. Juristisch wäre das die subjektive Funktionalitätserwartung, die sich gerade bei Bauherren und Erwerbern von kleinen Wohngebäuden oder Wohnungen »aufgeschaukelt« hat in Qualitäten, die Bauwerke heute eigentlich gar nicht mehr leisten können.
Beispielhaft seien hier die Erwartungshaltung bezüglich der vollständigen Rissfreiheit von Wänden oder das vollständige Abschirmen vor Nachbarschaftsgeräuschen genannt, die oft – auch ohne Funktionseinschränkung – als Reaktion fast nahtlos die direkte Einschaltung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nach sich zieht. Und uns ist klar: Er wird immer etwas finden! Wir können kein perfektes Gebäude liefern! Aber wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Was ist die »richtige« Qualität, mit der Bauherren, Nutzer, Bauausführende und Sachverständige leben können? Dafür muss man sich auf ein Gesamtpaket einigen.
Das ganze Interview können Sie in der Dezember-Ausgabe von »Bausachverständige« lesen.
Informationen zur Abo-Bestellung
PDF-Datei des Beitrags kostenlos herunterladen