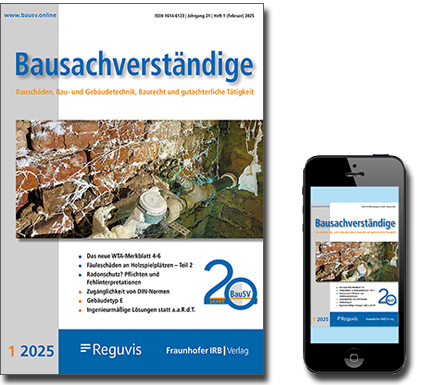Im Gespräch: Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller, AIBau, Aachen
Am 7. und 8. April 2025 finden die 51. Aachener Bausachverständigentage vor Ort in Aachen sowie online statt. Die zentralen Themen sind diesmal »Abdichtungen, Dächer, Beton und mehr«. Auch Kurzentschlossene können sich noch zur Tagung anmelden und entweder im Tagungszentrum oder online teilnehmen. Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller steht uns Rede und Antwort zu den spannenden Themen der Tagung.
BauSV: Die Aachener Bausachverständigentage haben sich – ebenso wie unsere Fachzeitschrift – unter anderem zum Ziel gesetzt, die Kommunikation zwischen Sachverständigen und Juristen zu erleichtern und zu verbessern. Was hat sich die Tagung in diesem Jahr diesbezüglich auf die Fahne geschrieben?
Zöller: Noch immer leiden gerichtliche Verfahren, aber auch außergerichtliche Beratungen unter, ich möchte es so sagen, Missverständnissen, die auf Problemen der Kommunikation beruhen. Kommunikation ist ein Werkzeug. Sachverständige und Juristen sprechen zwar dieselbe Sprache, nämlich deutsch, verstehen sich aber trotzdem gegenseitig oft nicht. Man könnte das Problem vergleichen mit Unterhaltungen zwischen Italienern und Franzosen.
Beide Sprachen gehen auf denselben Ursprung zurück, trotzdem sind die Barrieren für eine Verständigung hoch. Das liegt nicht an bösem Willen, sondern an den Unterschieden der technischen und der juristischen Welt mit ihren jeweiligen Denkweisen. Die beiden ersten Beiträge geben Lösungsansätze für eine bessere Kommunikation unter den Beteiligten sowie für die technische Unterstützung, die die Arbeit erleichtert.
BauSV: Die scheidende und voraussichtlich auch die kommende Bundesregierung setzen auf erneuerbare Energien. Energetische Nachhaltigkeit ist gerade in Krisenzeiten von Bedeutung, wenn sich Öl und Gas verknappen und die Energiekosten steigen. Viele private Häuslebauer, aber auch viele gewerbliche Immobilienverwaltungen, setzen daher auf Photovoltaikanlagen auf Wohn- und Industriegebäuden.
Gelegentlich hört man jedoch, dass derartige Anlagen in Brand geraten können. Was können Sachverständige dazu beitragen, die Brandgefahr durch Photovoltaikanlagen auf Dächern zu minimieren? Wie groß sind eigentlich die Risiken tatsächlich? Und was bietet die Tagung hierzu?
Zöller: Zunächst kann man die Bedeutung regenerativer Energien in Deutschland, wo es, mit Ausnahme der Verbrennung von Braunkohle, die mit dem hohen CO2-Ausstoß sowie den bekannten, erheblichen Nachteilen verbunden ist, keine Alternativen von Energiequellen gibt, nicht hoch genug einschätzen.
Die Erfahrungen in Frankreich zeigen, dass Atomstrom höchst problematisch ist. Die Baukosten eines Atomkraftwerks der EDF (Électricité de France) in Hinkley Point südlich von London sind von ca. 22 auf ca. 55 Mrd. Euro gestiegen. Die Fertigstellung verschiebt sich von ursprünglich 2023 auf voraussichtlich 2031. Die Gesamtkosten des Kraftwerks werden auf ca. 240 Mrd. Euro geschätzt. Nach Ende der Laufzeit der Kraftwerke beginnen Kosten und Probleme erst richtig. Zwar schätzt man für den Rückbau des Atomkraftwerks in Hinkley Point »nur« ca. 15 Mrd. Euro. Allerdings bleibt dabei unklar, wie die Kosten für die gefahrlose und sichere Lagerung des Atommülls für viele Jahrhunderte gesichert werden kann.
Unsere Nachfahren tragen die Kosten und Risiken, ohne dass sie jemals einen Nutzen hatten. Ein ungerechter Generationsvertrag. Ich befürchte, dass wir uns aufgrund der dann berechtigten Kritik noch im Grab umdrehen werden.
Neben der Versorgungssicherheit steht die Unabhängigkeit von, wie man heute leider feststellen muss, nicht immer vertragstreuen Partnern bezüglich der Lieferung von fossilen Energieträgern, aber auch von Uran für Atomkraftwerke.
Regenerative Energien sind unter Einbeziehung der Gesamtkosten sowie Energiespeichertechnologien nicht nur sicherer, sondern auch erheblich kostengünstiger als alle anderen Energieträger, von denen die meisten nicht unerheblich zur Klimaerwärmung beitragen und damit ein nicht unwesentlicher Faktor der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen sind.
Wir brauchen also in Deutschland zur Zukunftssicherung und zur Sicherung als Industriestandort zwingend den massiven Ausbau regenerativer Energien. Das ist nicht nur eine Frage der ökologischen Vernunft und der Zukunftssicherung, sondern vor allem eine ökonomische Frage.
In Deutschland gibt es die große ungenutzte Ressource der Flachdächer, insbesondere die von gewerblich oder industriell genutzten Hallen. Dächer können ohne nennenswerte Umweltauswirkungen mit Solargeneratoren bestückt werden. PV-Anlagen auf Dächern haben bereits eine weite Verbreitung gefunden und sind bereits jetzt eine nicht mehr wegzudenkende Energiequelle.
Allerdings müssen die Gebäude sicher nutzbar bleiben und auch versicherbar sein. Wenn dies nicht gewährleistet ist, liegt bereits ein immenser Schaden vor. Da es nicht zuletzt wegen des Urteils des OLG in Oldenburg von August 2019 eine große Verunsicherung bei den Versicherern gibt, werden »brandaktuell« und mit Hochdruck Empfehlungen und Versicherungsvorgaben, u.a. die neue VdS 6023, ausgearbeitet.
Die beiden Beiträge zu unserer Tagung beschäftigen sich mit zielgerichteten, aber wirtschaftlichen Maßnahmen zur Vermeidung der Brandgefahren und zur Verringerung von Brandfolgeschäden. Im weiteren Beitrag werden Maßnahmen vorgestellt, um die – oft vergessene – Instandhaltung von PV-Anlagen auf Dächern zu ermöglichen. Dazu zählen nicht nur Inspektion und Wartung im Normalbetrieb, sondern auch die gefahrlose Räumbarkeit von großen Schneemengen.
BauSV: Eine weitere spannende Frage ist ein Dauerbrenner, nämlich die DIN-Normen. Wie ist es um die DIN-Gläubigkeit der Sachverständigen bestellt? Es ist ja die Gretchenfrage, ob die DIN-Normen gesetzesgleich anzuwenden sind oder ob davon, ggf. sogar ohne Befreiung, abgewichen werden kann, wenn das Schutzziel eingehalten bzw. nachgewiesen wird.
Zöller: Mit dieser Frage beschäftigen wir uns seit ca. zehn Jahren. Mittlerweile ist der Umgang mit DIN-Normen ein wesentlicher Aspekt des Deutschen Baugerichtstags geworden.
A.R.d.T. sind Mindeststandards, die nicht unterschritten werden dürfen. Mindeststandard bedeutet, dass einerseits die Funktion sichergestellt sein muss und andererseits das Wirtschaftlichkeitsgebot sowie die Gesetze zur Circular Economy beachtet werden. Damit sind z.B. DIN keine a.R.d.T., wenn sie über oder unter diesen Mindeststandards liegen.
Wichtig ist die Differenzierung von technischen Mindeststandards zur Erreichung und Erhaltung der Funktion einerseits und Komfortstandards andererseits. Viele technische Festlegungen liegen über Mindeststandards. Komfortstandards kennen keinen Mindeststandard, wie der große Anteil aller Wohnungen des Altbaubestands sowie viele Wohnungen im Ausland zeigen. Dort lebt man sicherlich nicht schlechter, obwohl heute als notwendiger Standard angesehene Ausstattungen nicht vorhanden sind.
Sachverständigen kommt die wichtige Aufgabe zu, Mindeststandards zu beraten, die regelmäßig Vereinfachungen bedeuten, sowie Ausgeführtes nach der jeweils konkreten Verwendungseignung zu bewerten. Beides darf nicht ausschließlich auf Basis von z.B. DIN-Normen erfolgen.
Wer heute etwas plant und ausführen lässt, nur weil es in einer DIN-Norm vorgeschlagen wird, ohne dass dazu eine fallbezogene, konkrete technische Notwendigkeit besteht, kann sich für die daraus entstehenden Kosten schadenersatzpflichtig machen, weil gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen wurde.
Die Bedeutung von a.R.d.T. ist diesen Notwendigkeiten klarstellend anzupassen. Die regelmäßig unterstellte Vermutungswirkung, dass z.B. DIN-Normen a.R.d.T. seien, ist nicht (mehr) gerechtfertigt. Das könnte wieder der Fall sein, wenn sich Herausgeber und Arbeitsausschüsse von Technischen Empfehlungen an den Grundsätzen von Mindeststandards orientieren sowie ihre Arbeit und Entscheidungsgrundlagen transparent machen. Das wäre eine wichtige Grundlage für die Anerkennung der Bedeutung von DIN-Normen im Zusammenhang mit a.R.d.T. Wie sonst sollen Anwender herausfinden, ob eine Festlegung in einer DIN-Norm gegen einmalig einwirkende und abklingende Vorgänge gedacht ist, ob man es im Arbeitsausschuss einfach nur gut gemeint hat oder ob bei Abweichung von einer DIN-Norm tatsächlich Schäden zu erwarten sind?
Das betrifft u.a. Anforderungen des öffentlichen Baurechts, wobei dieses aufgrund des Schutzzielprinzips deutlich flexibler ist als oft gehandhabt. Frau Messer, die Leiterin der Bauordnung in der Senatsverwaltung der Stadt Berlin, wird uns darüber informieren, da insbesondere Sachverständige öffentliches Baurecht oft mit Zwang verwechseln.
Insbesondere im Zivilrecht ist der Umgang mit Mindeststandards auf technischen Notwendigkeiten neu zu überdenken. Es geht es nicht um die Beeinträchtigung der Sicherheit, sondern um ein teilweise grobes Übermaß an Anforderungen. Haben wir mit in der Zeit vor 2000 gebauten Wohnungen mit teilweise erheblichen geringeren Standards tatsächlich Probleme? Sind mehr als 80%, die Wohnungen nutzen, die älter als 25 Jahre sind, tatsächlich beeinträchtigt? Wie geht es unseren europäischen Nachbarn, die teilweise erheblich niedrigere (Komfort-)Standards haben?
Sachverständige sind mehr denn je gefordert, diese Entwicklungen sachlich zu beraten und zu begleiten, ohne auf zum Teil überholte Gepflogenheiten zurückzugreifen.
BauSV: Nachhaltigkeit beim Bauen ist auch ein sehr wichtiges Thema, dem sich wohl auch die Sachverständigen zukünftig mehr widmen müssen. Was müssen Sachverständige über Urban Mining wissen? Dieser Begriff ist ja in vieler Munde.
Zöller: Gemeint ist die Wiederverwendung von aus rückzubauenden Gebäuden gewonnenen Baustoffen bzw. deren Vorprodukte. Dies ist ein wichtiger Baustein zur Erhöhung der Recyclingquote von derzeit ca. 1% auf das europaweit gewollte Ziel von ca. 70%. Sicherlich ist die Effizienz der Rohstoffgewinnung bei mineralischen Baustoffen, insbesondere beim Rückbau von Beton, am höchsten. Allerdings wird das nicht ausreichen.
Der größte Teil von gebrauchten Rohstoffen wird aus Gebäuden gewonnen, die in Zeiten errichtet wurden, in denen die Gefahrenpotenziale vieler Stoffe (noch) nicht bekannt waren, die heute aber »auszuschleusen« sind. Wie können solche Bauteile und -stoffe weiter- oder wiederverwendet werden, ohne dass von ihnen Gefahren ausgehen können? Damit beschäftigt sich Frau Richardson in einem Beitrag zu unserer Tagung.
BauSV: Die Tagung wird sich auch den Baukosten widmen. In den letzten Jahren, vor allem seit Corona, sind die Baukosten übermäßig angestiegen. Die Ukraine-Krise hat ihr Übriges dazu beigetragen. Die Steigerung der Baukosten liegt aber nicht nur an den knapper werdenden Ressourcen. Welche Ursachen haben die Baukostensteigerungen noch und wie können Sachverständige dazu beitragen, diese in den Griff zu bekommen? Was tun, wenn es teurer wird?
Zöller: Auf Initiative der Architektenkammer Bayern und der Bundesarchitektenkammer hat sich die scheidende Bundesregierung mit dem Gebäudetyp E beschäftigt. Ich halte den Ansatz grundsätzlich für sehr begrüßenswert, denn eine Vereinfachung des Bauens ist eine große Chance, da viele vor der Alternative stehen, entweder eine günstige Wohnung mit geringen Standards oder keine Wohnung zu haben.
Allerdings unterscheidet der vorliegende Gesetzesentwurf nach Verträgen zwischen Kaufleuten (B2B, Business-to-Business) und zwischen Kaufleuten und Verbrauchern (B2C, Business-to-Customer bzw. Client). Es geht um das technische Verständnis zwischen den Vertragspartnern, um die »Augenhöhe« zwischen diesen beiden. Während eine Unterscheidung von den sogenannten anerkannten Regeln der Technik, die allzu häufig mit DIN-Normen und anderen technischen Empfehlungen gleichgesetzt werden, in B2B-Geschäften einfach möglich sein soll, ist das in Verträgen mit Verbrauchern mit großen Hürden und einer vertieften Aufklärungspflicht verbunden.
Gebäudetyp E ist zur Stärkung des Wohnungsbaus gedacht. Man hat aber dabei übersehen, dass nicht nur durch europäisches Unionsrecht alle in Wohnungen lebenden Personen Verbraucher sind, und zwar unabhängig von ihrem technischen Können oder Verständnis. Die meisten Wohnungen werden durch Verbraucher-Bauverträge errichtet. Wie aber sollen z.B. Architekten Verbraucher informieren, wenn sie zum Zeitpunkt der Planungsentscheidungen diese noch gar nicht kennen, weil Wohnungen nicht verkauft sind?
Andererseits erfordern die stetig steigenden Anforderungen und damit auch stetig steigenden Baukosten von allen Baubeteiligten ein Umdenken, damit überhaupt noch gebaut werden kann. Das liegt nicht nur an den knapper werdenden Ressourcen, sondern insbesondere an einer stetig steigenden Erwartungshaltung und damit verbundenen, sich nach oben entwickelnden Anforderungs- und Kostenspiralen.
Gebäudetyp E ist aufgrund der oben beschriebenen Probleme kein wirksames Instrument, zumal Architekten mit zusätzlichen Beratungsverpflichtungen überzogen werden, die sie angesichts der schieren Anzahl von technischen Empfehlungen nicht beherrschen können und darüber hinaus keinen zusätzlichen Cent Honorar bekommen. Ich verstehe das hehre Ziel der Architektenschaft, einfache Standards vorzuschlagen. Im Gebäudetyp-E-Gesetzesentwurf sehe ich aber keinen nennenswerten Nutzen, sondern nur eine Belastung insbesondere für Architekten.
Es bedarf daher anderer Überlegungen, um Baukosten nicht nur zu stabilisieren, sondern wieder auf ein bezahlbares Maß abzusenken. Dazu gehört nicht nur das Ende einer »Wärmeschutzrallye«, sondern Standards allgemein. Man muss keine Angst haben, dass die Bude kalt bleibt oder man in Wohnungen geringer Standards krank wird – das beweisen, wie bereits ausgeführt, der große Anteil bestehender Wohnungen und die Wohnungsstandards in europäischen Nachbarländern. Diese Fragen wollen wir im Rahmen des aktuellen Themas diskutieren.
BauSV: Sehr geehrter Herr Professor Zöller, haben Sie vielen Dank. Wir alle freuen uns auf eine spannende Fachtagung.
Zöller: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen, allen Teilnehmenden und uns einen anregenden und gewinnbringenden Austausch, der uns in den aktuellen, unter den Nägeln brennenden Themen weiterbringen wird.
Hinweis der Redaktion
Auch Kurzentschlossene können sich noch zur Tagung anmelden und entweder im Eurogress Aachen (Europasaal), Monheimsallee 48, 52062 Aachen oder online teilnehmen. Wer vor Ort ist, hat die Gelegenheit, sich in Pausengesprächen oder am Abend des ersten Veranstaltungstags ab 19.00 Uhr im Foyer des Eurogress bei Bier, Wein und guten persönlichen Gesprächen auszutauschen. Die begleitende Fachmesse geht bis zum 8. April, 14.00 Uhr.
Kontakt
Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller
AIBau gGmbH
Theresienstraße 19
52072 Aachen
Telefon: 0241 910507-0
Telefax: 0241 910507-20
E-Mail: info@aibau.de
Internet: www.aibau.de
Links